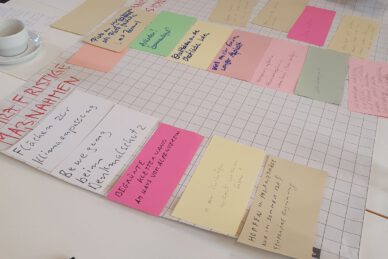Interview mit Mobilitätsreferent Georg Dunkel
| Michael Schneider |
Im Juni 2021 wurde im Stadtrat die Mobilitätsstrategie 2035 beschlossen. Die 19 Teilstrategien enthalten den Plan für die Mobilitätswende in München. Zeit, beim Mobilitätsreferenten Georg Dunkel nachzufragen, wie weit München seither gekommen ist.
Michael Schneider: Parken ist ein hochemotionales Thema in München. Starten wir doch gleich mit dem Fahrradparken. Hier am Rindermarkt war es gar nicht so leicht, einen Radlparkplatz zu finden. Wie ist denn die Entwicklung?
Georg Dunkel: Fahrradparken ist ein zentraler Baustein für die Zufriedenheit aller Fahrradfahrenden in dieser Stadt. Wir wollen, dass die Fahrräder gut und sicher abgestellt werden können. Wir machen da viel. Die letzten Jahre hat es das Baureferat geschafft, etwa 1.500 neue Fahrradparkplätze jährlich zu errichten. Mobilitätsreferat, Baureferat und Bezirksausschüsse sind da in sehr guter Abstimmung. Bezirksausschüsse äußern ihre Wünsche, wo sinnvollerweise neue Fahrradstellplätze hin sollten, und wir prüfen das dann. Sie kennen sich vor Ort auch am besten aus. Neben dem Fahrrad gehören inzwischen auch unsere E-Tretroller dazu. In der Altstadt sind sie jetzt komplett an festen Abstellplätzen, etwa 95 Prozent dieser Geräte stehen jetzt dort, das bringt viel mehr Ordnung in den öffentlichen Raum, hält den Gehweg frei, wo wir vorher viele Probleme hatten. Es ist noch lange nicht perfekt, und wir müssen das jetzt auch in die Stadtbezirke ausdehnen. Wir haben in den letzten Jahren auch flexible Parkmöglichkeiten ausprobiert, etwa Tag-Nacht-Nutzungen gerade im Uni-Umfeld. Tagsüber Fahrradparken, nachts Bewohnerparken mit dem Pkw. Es hat sich aber gezeigt, dass das nicht richtig gut funktioniert, denn die Missbrauchsquote am Vormittag ist noch zu hoch. Das Auto steht dann doch noch da und ist nicht entfernt worden. Das werden wir nicht weiterverfolgen. Was wir aber weiterverfolgen ist das Flexparken im Sommer und Winter. Wir brauchen im Sommer mehr Fahrradparkplätze, gerade im Bereich von Eisdielen bietet es sich einfach an.
Michael Schneider: Wir haben gerade über das Fahrradparken im öffentlichen Raum gesprochen. Was können denn auch Private tun, um das Fahrradparken in München zu begünstigen?
Georg Dunkel: Es wird nicht nur mehr radgefahren, die Fahrräder werden hochwertiger. Der Wunsch, gerade auch zu Hause sichere Abstellmöglichkeiten zu schaffen, wächst. Teilweise geht da nicht viel, so ehrlich muss man sein, gerade in vielen Altstadtquartieren oder auch in Gründerzeitvierteln. In Neubauquartieren haben wir über Bebauungspläne beziehungsweise auch über unsere Fahrradstellplatzsatzungen die Quoten deutlich erhöht.
Michael Schneider: Im Vergleich mit Fahrrädern haben Autos einen ganz anderen Flächenbedarf beim Parken. Daran entzünden sich auch immer wieder sehr heftige Auseinandersetzungen in der Stadt. Wie entwickelt sich die Zahl der abgestellten Kraftfahrzeuge im öffentlichen Raum?
Georg Dunkel: Die Zulassungszahlen gingen die letzten Jahre noch leicht nach oben. Im letzten Jahr ist erstmals eine gewisse Stagnation festzustellen. Die Zahl der privat zugelassenen Pkw stagniert schon länger. Wir haben aber eine zunehmende Zahl der gewerblich gemeldeten Pkw in dieser Stadt. Aus der repräsentativen Befragung zum Mobilitätsverhalten (SrV ) wissen wir, wie viele Wege in dieser Stadt mit welchen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden. Das Auto kommt auf 24 Prozent der Wege. Wir haben mehr Autos, die aber weniger gefahren werden. Wir wissen nicht, wie viele davon auf einem privaten Stellplatz stehen und wie viele im öffentlichen Raum. Wir brauchen noch weitere Ideen, wie wir Leute anschubsen können, die nicht wirklich aufs Auto angewiesen sind, um die Anzahl der abgestellten PKW zu reduzieren. Es ist eine Frage der Flächeneffizienz und der Flächengerechtigkeit.
Michael Schneider: Der Prinz-Eugen-Park im Münchner Osten ist ja in seiner Entwicklung auch wegen des Mobilitätskonzepts sehr gelobt worden. Damit wollte man ja auch den Autobesitz dort reduzieren. Wenn man durch das Quartier läuft, sind die Straßen schon recht voll mit parkenden Fahrzeugen, zum Teil auch widerrechtlich geparkt im Halteverbot. Werden in Münchner Neubauquartieren bestehende Garagen einfach nicht genutzt, weil es bequemer ist, im Straßenraum zu parken? Oder ist der Autobesitz auch in so autoreduzierten Quartieren dann doch überraschend hoch? Wenn ja, was bedeutet das dann für Freiham?
Georg Dunkel: Freiham ist eine Weiterentwicklung von vielem, was wir aus der Prinz-Eugen-Kaserne, dem Prinz-Eugen-Park, aber auch dem Domagk-park gelernt haben. In vielen anderen Neubauquartieren der letzten Jahre sind wir sukzessive weitergegangen in der Entwicklung unserer Mobilitätskonzepte. Der reduzierte Stellplatzschlüssel hat sich aus meiner Sicht sehr bewährt. Den Domagk-park finde ich besonders gelungen, da sehe ich auch keinen großen Parkdruck auf der Straße, was aber vielleicht auch damit zusammenhängt, dass es uns da gelungen ist, auch gleich ein Parkraum-Management im öffentlichen Straßenraum zu etablieren. Am Ende brauchen wir auch eine Preisgerechtigkeit zwischen dem Abstellen im öffentlichen Raum und dem Abstellen auf Privatgrund, auch im Prinz-Eugen-Park: Wir kennen die Auslastung der Garagen nicht im Detail. Aber wir wissen, dass die Nutzung dieser Garagen auch Miete kostet. Da wird es mit Sicherheit auch den einen oder die andere geben, die sich lieber einen Stellplatz im öffentlichen Raum sucht, solange es irgendwie geht, bevor man 60 Euro im Monat oder mehr zahlt. Wir wollen eine Steuerung vornehmen, um den zur Verfügung stehenden Parkraum gut zu nutzen. Ich glaube, am Ende haben wir in dieser Stadt womöglich gar keinen Parkplatzmangel. Es gelingt uns nur nicht, die zur Verfügung stehenden privaten Stellplätze auch besser, also mehrfach, zu nutzen. Das wird eines der zentralen Themen der nächsten Jahre.
Michael Schneider: Da hätte ich einen ganz guten Kooperationspartner für Sie gefunden: die Parkraumwende München . Die Initiative hat sich letztes Jahr gegründet und sich genau das auch zum Ziel gesetzt, dass man bis jetzt nicht genutzten Parkraum entweder in Tiefgaragen oder auch in Hochgaragen zusammenbringt mit Menschen, die parken müssen. Gab es da bereits erste Kontakte?
Georg Dunkel: Wir sind im Austausch mit der Initiative. Ich finde das auch sehr lobenswert. Wir sind auch im Austausch mit Unternehmen, die anbieten, über eine App verfügbaren oder frei verfügbaren Parkraum anderen Nutzer:innen zur Verfügung zu stellen. Da müssen wir noch viele Fragen klären. Viele Stellplätze sind ja mit einer gewissen Nutzung von der Lokalbaukommission genehmigt. Wenn wir diese Nutzungen erweitern, müssen wir prüfen, unter welchen Voraussetzungen wir das rechtlich dürfen. Also: dass tagsüber der Gewerbebetrieb es nutzt, abends dann derjenige, der ins Fitnessstudio geht oder nachts der Bewohner, so dass wir dann eine zwei- bis dreifache Nutzung dieser Stellplätze hinbekommen. Wir werden bei der hohen Pkw-Dichte Lösungen finden müssen.
Michael Schneider: Immer wieder für heftige Proteste sorgt hier auch der Wegfall von Autoparkplätzen, wenn Radwege eingerichtet oder beispielsweise Schanigärten im Sommerhalbjahr auf städtischen Straßen geschaffen werden. Wie reagiert die Landeshauptstadt auf diese Proteste? Haben Sie da eine bestimmte Strategie, um diese Konflikte befrieden zu können?
Georg Dunkel: Die Hauptstrategie ist miteinander reden. Oft wird uns vorgeworfen, wir würden das aus rein ideologischen Gründen machen. Schanigärten wurden in Corona-Zeiten eingeführt. Alle waren froh, auch der Gastronomie wieder eine Unterstützung zu geben. Wir feiern uns gerne auch als die nördlichste Stadt Italiens und genießen das Leben gerade im Sommerhalbjahr auf der Straße. Die letzten ein, zwei Jahre merkt man eine gewisse Umkehr, es gibt mehr Kritik an den Schanigärten, dass da zu viele Parkplätze wegfallen würden. Gleichzeitig bekommen wir auch Kritik, weil wir neue Fahrradstellplätze errichten, und wir schaffen gerade flächendeckend in der Stadt 200 Mobilitätspunkte, wo wir für Carsharing Stellplätze zur Verfügung stellen. Der Wandel, den wir im Straßenraum vornehmen, entspricht klar unserer gesamten Mobilitätsstrategie. Wir machen eine Abwägung danach, wie sich das Mobilitätsverhalten entwickelt hat. Ein Drittel der Wege in dieser Stadt werden zu Fuß zurückgelegt, gut 20, 21 Prozent der Wege mit dem Fahrrad. Zusammen sind das über 50 Prozent der Wege. Dafür brauchen wir sichere, breite Gehwege. Wir brauchen gute Fahrradinfrastruktur. Das Auto, das „nur“ noch 24 Prozent der Wege abdeckt in dieser Stadt, ist auch wichtig. Wir müssen den Raum für das Auto etwas reduzieren, um den knappen Raum besser zu nutzen.
Michael Schneider: Gerade fiel das Stichwort breite und sichere Gehwege. Am 25. Juni schrieb die TZ, dass Clemens Baumgärtner, der OB-Kandidat der CSU, den Vorschlag gemacht hat, das sogenannte aufgesetzte Parken zu legalisieren. Zur Erklärung: Aufgesetztes Parken heißt, die Fahrbahn ist nicht breit genug aus Sicht des Autofahrers, dass man ein Fahrzeug mit allen vier Rädern auf der Fahrbahn parkt, sondern damit eben durchfahrende Fahrzeuge noch genügend Platz haben, stellt man sich mit den rechten beiden Rädern auf den Gehweg, wodurch der Gehweg verschmälert wird. Was sagen Sie aus fachlicher Sicht zu diesem Vorschlag?
Georg Dunkel: Schwierig, ein sensibles Thema. Ich gehe davon aus, es wird von verschiedenen Fraktionen eines der Wahlkampfthemen werden. Wir müssen nüchtern darauf schauen. Wir haben einen hohen Parkdruck in vielen Quartieren. Jahrzehntelang wurde das Gehwegparken praktiziert. Viele fragen sich: Wollt ihr das jetzt zurücknehmen? Wir sind nicht die böse Verwaltung, die hier irgendwas zurücknehmen will. Es war immer schon rechtlich nicht zulässig und hätte von der Polizei immer schon geahndet werden können. Es wurde aber stillschweigend toleriert. Zunehmende Teile der Gesellschaft akzeptieren das so nicht. Viele sind mit Kindern unterwegs, mit dem Kinderwagen, mit einem Rollator, mit dem Rollstuhl. Da brauchen wir sichere, breite Gehwege. Die Mindestbreite ist gesetzlich nicht klar definiert. Es gibt viele Richtlinien und Empfehlungen von Forschungsgesellschaften, die sagen, eigentlich braucht es zwei Meter. Es gibt auch Institutionen, die sagen, 1,60 Meter könnte reichen. Und Clemens Baumgärtner sagt, 1,50 Meter könnte reichen. Aber selbst 1,50 Meter haben wir auf vielen Gehwegen gar nicht. Wir haben dem Stadtrat vorgeschlagen, dass wir in Kooperation mit den Bezirksausschüssen, mit der Polizei und den Behindertenverbänden uns die Stadtteile anschauen, wo die Probleme wirklich am größten sind. Bewohnerparken in einem Lizenzgebiet einzuführen ist ein gutes Instrument. Damit haben wir in den letzten Jahren in vielen Quartieren gute Erfahrungen gemacht, konnten damit dann auch früher praktiziertes Gehwegparken abschaffen.
Michael Schneider: Kann denn die Landeshauptstadt auch etwas tun gegen das Parken besonders großer Fahrzeuge, zum Beispiel Wohnmobile, zum Beispiel auch SUVs? Da gab es ja vor einigen Monaten auch die Meldung aus Paris, dass sich bei einer Bürgerabstimmung eine Mehrheit der Abstimmenden dafür ausgesprochen hat, dass man für SUVs im Stadtbereich höhere Parkgebühren erhebt als für kleinere Fahrzeuge.
Georg Dunkel: Es sollte uns als Kommune die Möglichkeit gegeben werden, beim Bewohnerparken über die Preise nochmal neu zu verhandeln, damit wir nach Größe der Fahrzeuge staffeln können. Andere Städte gehen da jetzt mit einem Beispiel voran, das schauen wir uns natürlich auch sehr genau an. Die rechtliche Möglichkeit wäre dann grundsätzlich da. In einem ersten Schritt stellen wir ab 1. August in bestehenden Bewohnerparkgebieten für Wohnmobile, die länger als 6 Meter sind, künftig keine neue Parklizenz mehr aus. Es gibt Bestandsschutz, alle, die heute eine Lizenz haben, werden sie auch in Zukunft weiterhin bekommen Aber wir wollen die Botschaft setzen an alle, die sich jetzt ein Wohnmobil anschaffen: Könnt ihr gerne machen, aber wenn es länger als sechs Meter ist, kümmert euch bitte privat um eine Abstellmöglichkeit. Es ist nicht gerechtfertigt, für die wenigen Male im Jahr, die ein Wohnmobil genutzt wird, dauerhaft den sehr knappen Parkraum in unserer hochverdichteten Stadt so günstig zur Verfügung zu stellen.
Michael Schneider: Was wir die letzten Jahre in München alle beobachten können, das ist, dass die abgestellten Autos immer breiter werden, immer länger werden, auch immer höher werden. Was bedeutet das denn für die Verkehrssicherheit?
Georg Dunkel: So ganz kann man es noch nicht abschätzen. Wir müssen aufpassen in den sogenannten Sichtdreiecken, also in allen Kreuzungen. Da ist es sehr wichtig, dass auch Kinder gut gesehen werden, wenn sie die Straße queren wollen. Je höher die Fahrzeuge werden, desto schwieriger kann das werden. Wir sehen da keine erhöhten Unfallzahlen. Wir versuchen aber, dass wir Fahrradparkplätze an solchen Kreuzungen schaffen, um das Abstellen von Kraftfahrzeugen grundsätzlich unmöglich zu machen. Richtig aktiv werden können wir darüber hinaus eigentlich nur, wenn Fahrzeuge wirklich verkehrsgefährdend abgestellt sind. Dann ordnen wir reines PKW-Parken an, wenn die Sichtbeziehungen überhaupt nicht mehr gegeben sind und es ein wichtiger Schulweg ist.
Michael Schneider: Wie hat sich die Zahl der Verkehrsunfallopfer seit 2021, seitdem Sie im Amt sind, entwickelt?
Georg Dunkel: Ein paar Jahre mehr zurückblickend merken wir eine klare Tendenz der Abnahme. Das ist sehr positiv. Im Jahr 1972 hatten wir noch 258 Getötete im Straßenverkehr in dieser Stadt. Es sind jetzt zwischen 10 und 20. Die letzten Jahre waren es häufig neun Verkehrstote. Das sind neun zu viel. Auch die Schwerstverletzten sind nach wie vor zu viele. Zwei Drittel der Unfallopfer sind Fußgänger oder Radfahrer, das ist der klare Hinweis, wo unsere Ansatzpunkte sind. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass der Fuß- und Radverkehr noch sicherer in dieser Stadt wird. Daran arbeiten wir mit der Polizei und mit dem Baureferat intensiv. Wir sind Mitglied der Unfallkommission und haben uns jetzt die Unfallschwerpunkte der letzten Jahre angeschaut. Wir haben auch ein Prioritätenprogramm entwickelt, welche Knotenpunkte in den nächsten Jahren umgebaut werden sollen. Das betrifft freilaufende Rechtsabbieger, eine Maßnahme, an der wir intensiv arbeiten. Es geht aber auch um Verbesserungen von Sichtbeziehungen und Roteinfärbungen von Radwegen. Da ist schon viel passiert, aber auch noch viel zu tun.
Michael Schneider: Die Vision Zero ist ja die Vision, dass es im Straßenverkehr keine Todesopfer und keine Verletzten mehr bei Unfällen gibt. Was hat die Landeshauptstadt bei der Vision Zero selbst in der Hand? Wie hilft Ihnen da die neue Straßenverkehrsordnung?
Georg Dunkel: Wir sind froh über die Novelle der Straßenverkehrsordnung, weil sie neue Perspektiven für Tempo 30 gibt, aber auch für die Schaffung von besseren Fuß- und Radwegen. Auch die Anordnung von Fußgängerüberwegen ist einfacher geworden. Früher brauchten wir die berühmte qualifizierte Gefahrenlage, es musste schon ein Unfall passiert sein, bevor wir handeln durften. Das ist jetzt vielfach weggefallen. Wir dürfen präventiv sagen: Hier ist ein geeigneter Standort für einen Fußgängerüberweg. Im Umfeld von einem Fußgängerüberweg gibt es jetzt auch die Kann-Regel, dass wir da gleichzeitig Tempo 30 anordnen dürfen.
Michael Schneider: Abschließend, Herr Dunkel. Finden Sie denn, dass die Städte und Gemeinden in Deutschland genügend rechtliche Möglichkeiten haben, um die Mobilitätswende zu gestalten?
Georg Dunkel: Ich muss an dieser Stelle das Thema der Finanzen ansprechen: Das Rückgrat einer Metropolregion ist ein leistungsfähiger ÖPNV. Da stehen wir aus meiner Sicht an einer ganz zentralen Stelle für die Zukunft: Wie gelingt es uns, den Betrieb des bestehenden ÖPNV zu sichern, aber auch den notwendigen Ausbau? Die Kommune allein ist überfordert, da brauchen wir Unterstützung von Bund und Land.
Michael Schneider: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Georg Dunkel: Vielen Dank Ihnen.
Der Interviewpartner:

Georg Dunkel
Georg Dunkel leitet das Mobilitätsreferat der Landeshauptstadt München. Er wirkt in stadtweiten, regionalen und nationalen Zusammenschlüssen und Verbänden mit, unter anderem in der Inzell-Initiative, der Europäischen Metropolregion München, der Fachkommission Verkehrsplanung des Deutschen Städtetages, der Agora Verkehrswende sowie der Plattform Urbane Mobilität.
Dieser Text stammt aus dem Online-Magazin STANDPUNKTE 07./08./09.2025 Scheitert die Mobilitätswende?
Bildquellen:
- Verkehrsschilder auf einer Baustelle: Friedrich Grössing
- Georg Dunkel: Michael Nagy / Presseamt